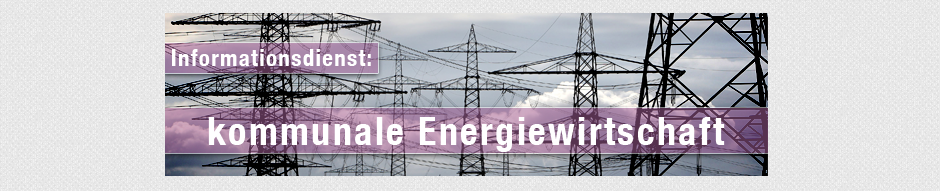Die Bundesnetzagentur hat jetzt die Ergebnisse der Ausschreibungen für Windenergie an Land sowie Solaranlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden vom 1. Februar 2025 bekanntgegeben – mit bemerkenswertem Ergebnis: Beide Ausschreibungen waren stark überzeichnet, also deutlich stärker nachgefragt als das ursprünglich ausgeschriebene Volumen. Für Windenergieanlagen an Land wurden demnach Zuschläge für insgesamt 422 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 4.094 Megawatt (MW) erteilt. Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert lag bei 7,00 Cent pro Kilowattstunde, wobei der höchste bezuschlagte Gebotswert bei 7,13 Cent und der niedrigste bei 5,62 Cent pro Kilowattstunde lag. Das ursprünglich ausgeschriebene Volumen lag bei 3.210 MW – wurde also deutlich übertroffen. Auch bei den Solaranlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden war das Interesse groß: Hier wurden 245 Gebote mit einem Gesamtvolumen von 366 MW bezuschlagt – bei einem ursprünglich ausgeschriebenen Volumen von 217 MW. Der durchschnittliche Zuschlagswert lag bei 8,55 Cent pro Kilowattstunde, wobei die Bandbreite der Gebote von 5,00 bis 8,91 Cent reichte. Für Kommunen sind diese Ergebnisse in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Sie zeigen nicht nur das hohe Engagement von Projektentwicklern und Investoren im Bereich erneuerbarer Energien, sondern auch die zunehmende Bedeutung kommunaler Flächen, Genehmigungen und Standortentscheidungen. Die Entwicklung belegt, dass der Ausbau von Wind- und Solarenergie weiter an Tempo gewinnt – und dass es sich für Kommunen lohnt, sich aktiv in diese Prozesse einzubringen. Durch eigene Beteiligungen, die Bereitstellung geeigneter Flächen oder die Unterstützung bei Genehmigungsverfahren können Städte und Gemeinden einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten – und zugleich regionale Wertschöpfung und Klimaschutz vor Ort stärken. Weitere Informationen und die vollständigen Ergebnisse der Ausschreibungen sind auf der Website der Bundesnetzagentur abrufbar. (BNetzA, 25.03.2025) Ganzer Artikel hier…
Umweltfreundliche Wärme für Aachen und die Region
Zur langfristigen Sicherung der Versorgung der angeschlossenen Haushalte in Aachen und der Region mit Fernwärme haben die STAWAG, die MVA Weisweiler GmbH & Co KG und die RWE Power AG zwei umfangreiche bilaterale Kooperationsverträge unterzeichnet. Seit den 90er Jahren nutzt die STAWAG – Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG Abwärme aus dem Braunkohlekraftwerk Weisweiler der RWE Power AG zur Wärmeversorgung der Stadt Aachen. Da der letzte Kraftwerksblock im Rahmen des Kohleausstiegs von RWE bis zum 1. April 2029 abgeschaltet wird, gehen die Partner einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft: Im Rahmen der Kooperation wird die Wärme ab April 2029 vollständig kohlefrei bereitgestellt. Zur Dampferzeugung wird die Energie genutzt, die bei der Müllverbrennung ohnehin freigesetzt wird. Rund 65 Mio. Euro investiert die MVA Weisweiler in eine entsprechende Turbine zur sogenannten Kraft-Wärme-Kopplung. Die gleichzeitige Produktion von Dampf und Strom nutzt die eingesetzten Energieträger effizient aus und erzielt erfreulich hohe Wirkungsgrade. RWE transportiert die ausgekoppelte Wärme über die bestehende, ca. 17 Kilometer lange Leitung nach Aachen und über andere Leitungen – in kleineren Mengen – zu benachbarten Kommunen wie z.B. Eschweiler und Inden. „Als Vorreiter der Energiewende haben wir nicht nur den Bau von Wind- und Solarparks vorangetrieben, sondern auch die Fernwärme kontinuierlich weiter ausgebaut“, sagt Dr. Christian Becker, Vorstand der STAWAG. „Dabei wollen wir die Fernwärme erstens für noch mehr Menschen verfügbar machen. Zweitens ist uns ein besonderes Anliegen, die Fernwärme zukünftig möglichst klimafreundlich zu produzieren. Dazu setzen wir auf einen neuen Erzeugungsmix: Dieser umfasst nicht nur die Auskopplung aus der Müllverbrennungsanlage, sondern auch die Nutzung von Tiefengeothermie, Thermalquellen und weiteren Wärmeauskopplungen. Mit der heutigen Vertragsunterzeichnung besiegeln wir diesen Schritt.“ Das genau bestätigt sehr deutlich die stellvertretende MVA-Aufsichtsratsvorsitzende, Frau Kerstin Abraham (Vorständin der Stadtwerke Krefeld): „Mit der heutigen Unterschrift geht die MVA Weisweiler erneut einen großen Schritt in Richtung Klimaschutz. Dies ist so wichtig für die gesamte Region Aachen und Düren.“ „Wir verbessern unseren energetischen Wirkungsgrad auf das Doppelte und reduzieren zudem die Wärmeverluste über den Kühlturm erheblich“, sagt voller Stolz Andreas Fries, Technischer Geschäftsführer. „Diese große Investition ist zudem abgesichert über faire und partnerschaftliche Konditionen“, ergänzt Herbert Küpper, Kaufmännischer Geschäftsführer. „Mit dem Vertrag sichern wir gemeinsam mit unseren Partnern nicht nur die Wärmeversorgung nach dem Kohleausstieg am traditionsreichen Energiestandort Weisweiler. Damit leisten wir auch einen weiteren Beitrag für die Region im Strukturwandel“, sagt RWE-Power-Vorstandsmitglied Dr. Lars Kulik. „In Zukunft können wir zudem mit der geplanten Geothermienutzung und dem vorhandenen elektrischen Hilfsdampferzeuger weitere nachhaltige Wärmelösungen realisieren.“ Die neue Turbine der Müllverbrennungsanlage Weisweiler wird eine Wärmeleistung von 95 Megawatt haben und jährlich rund 300 Gigawattstunden Wärme für Aachen und die anderen Kommunen produzieren. Dies entspricht in etwa der Menge, die die STAWAG bereits heute aus der Wärmeauskopplung aus dem Braunkohlekraftwerk bezieht. (STAWAG, 12.03.2025) Ganzer Artikel hier…
Stadtwerke Bernau und Trianel intensivieren Zusammenarbeit
Die Stadtwerke Bernau GmbH hat einen umfassenden Kooperationsvertrag mit der Trianel GmbH aus Aachen geschlossen, um gemeinsam den Weg der Transformation zu gehen. In diesem Zusammenhang haben sich die Stadtwerke Bernau als zehnter Partner „Trianel Connect“ angeschlossen und profitieren künftig von der Analyse und der Bewertung von Zukunftstrends, die das Trianel Trendscouting für über 60 Stadtwerke erarbeitet. Zudem nutzen die Stadtwerke Bernau künftig das Digital Lab von Trianel, um digitale Pilotprojekte umzusetzen und daraus Geschäftsmodelle zu entwickeln. „In Zeiten zunehmenden Wettbewerbs müssen gerade wir als kleineres Stadtwerk mit innovativen Geschäftsmodellen punkten. Die Energiewelt dreht sich immer schneller und wir sind einem zunehmend intensiveren Wettbewerb an allen Fronten exponiert. Hier ist der Netzwerk-Gedanke von Trianel der richtige Ansatz, die Energieversorgung der Zukunft aktiv zu gestalten,“ erklärt Detlef Stoebe, Geschäftsführer der Stadtwerke Bernau die Beweggründe. „Daher haben wir uns entschlossen, unsere bereits bestehende Zusammenarbeit auszuweiten, und freuen uns auf viele inspirierende Netzwerk-Treffen und den konstruktiven Erfahrungsaustausch.“ Die Stadtwerke Bernau gehören bereits seit 2023 dem „Trianel FlexStore“ an, in dem aktuelle Entwicklungen im Bereich Flexibilisierung beobachtet und wirtschaftliche Konzepte rund um Wasserstoff, Batteriespeicher und grüne Wärme entwickelt werden. „Wir freuen uns, dass die Stadtwerke Bernau die Zusammenarbeit mit uns vertiefen und das Vertrauen ausgesprochen haben. Damit wird das kommunale Netzwerk weiter gestärkt,“ beschreibt Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel GmbH die Zusammenarbeit. „Wir sehen darin eine Bestätigung unseres Ansatzes, die dynamischen Prozesse der Energiewelt für die Stadtwerke zu beobachten und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Wir sind der Überzeugung, dass dies der entscheidende Faktor für eine erfolgreiche Transformation ist.“ (Trianel, 21.03.2025) Ganzer Artikel hier…
Neues Gutachten im Auftrag von VKU und ZVEI belegt Anpassungsbedarf bei Netzentgelten
Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) und der ZVEI (Verband der Elektro- und Digitalindustrie) unterstützen das im Sondierungspapier von Union und SPD festgehaltene Ziel, die Stromkosten um fünf Cent pro Kilowattstunde abzufedern. Das stärke den Wirtschaftsstandort Deutschland und reduziere die Belastung für Industrie, Gewerbe und Privathaushalte. Damit die konkret genannte Entlastung auch bei allen Kunden ankomme, fordern die beiden Verbänden auf Basis eines gemeinsam beauftragen Gutachtens nun eine zügig Nachschärfung der vorgesehenen Maßnahmen. Bislang wird eine Halbierung der Übertragungsnetzentgelte diskutiert. Damit würden aber KMU sowie private Haushalten um deutlich weniger als die genannten fünf ct/kWh entlastet, so VKU und ZVEI. Um das politische Ziel zu erreichen, müssten zum Beispiel Zuschüsse zu den Übertragungsnetzentgelten sowie den netzbezogenen Umlagen gewährt werden. Das zeigt das Gutachten des Beratungsunternehmens Consentec, das im Auftrag der beiden Verbände die Umsetzbarkeit und Auswirkungen verschiedener weiterer Zuschuss-Varianten untersucht hat. Mit rund 30 Prozent haben diese beiden Posten einen erheblichen Anteil am Strompreis. Die beiden Verbände schlagen daher eine hälftige Aufteilung der Zuschüsse auf die Übertragungsnetzentgelte auf der einen sowie Zuschüssen zu den sogenannten netzbezogenen Umlagen auf der anderen Seite vor. Zuschüsse zu den netzbezogenen Umlagen würden vorrangig bei Haushalten, Handwerk, Kleingewerbe, Krankenhäusern und Schulen Entlastungen in bundesweit einheitlicher Höhe bewirken. So würden insgesamt sowohl Großverbraucher als auch kleine und mittlere Verbraucher profitieren. Allein die netzbezogenen Umlagen, wie der Aufschlag für die besondere Netznutzung und die Offshore-Netzumlage, die laut Gutachten zusammen derzeit etwa sieben Milliarden Euro jährlich ausmachen, bieten ein erhebliches Potenzial für Preissenkungen. „Für die Energiewende brauchen wir die Akzeptanz der ganzen Bevölkerung“, mahnte VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing. Wenn Letztverbraucher in unterschiedlichen Netzgebieten unterschiedlich stark entlastet werden, sei das nicht förderlich, sondern hat das Potenzial, die Gesellschaft weiter auseinander zu bringen. „Effizienter Klimaschutz geht nur durch Elektrifizierung, zum Beispiel bei Elektromobilität und Wärmepumpen. Genau daher muss die neue Bundesregierung darauf achten, dass die genannten fünf Cent pro Kilowattstunde Strompreissenkung auch bei allen Verbrauchern ankommen“, betonte Wolfgang Weber, Vorsitzender der ZVEI-Geschäftsführung. Auf Dauer werde es nicht reichen, die derzeit geplanten sechs Milliarden Euro an Bundeszuschüssen zur Entlastung der Übertragungsnetzentgelte hälftig aufzuteilen. Damit bei den Endverbrauchern am Ende mindestens fünf Cent Kostenentlastung pro Kilowattstunde ankommen, wie im Sondierungspapier festgehalten, müsste die Lücke von rund zwei Cent je Kilowattstunde bei der geplanten Entlastung durch zusätzliche Mittel geschlossen werden. Sonst könnte bei den Endkunden der Eindruck einer Mogelpackung entstehen, warnen die beiden Verbände. (VKU/ZVEI, 17.03.2025) Ganzer Artikel hier…
Pragmatischer Ansatz: der Integrierte Kapazitätsmarkt
Der BDEW hat jetzt eine von Frontier Economics erstellte Studie zur Einbindung dezentraler Flexibilitäten in einen Integrierten Kapazitätsmarkt (IKM) veröffentlicht. Zentrales Element des IKM sind wettbewerbliche Ausschreibungen, die stabile Investitionsbedingungen für steuerbare Kapazitäts- und Flexibilitätsoptionen schaffen sollen. Die Bedarfsermittlung basiert auf einem Ansatz, der verschiedene Mechanismen einbezieht. Dazu zählen Beiträge aus der Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das geplante Kraftwerkssicherheitsgesetz (KWSG), das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) sowie aus Flexibilitätsanreizen der Energie- und Systemmärkte. In dezentralen Kapazitätsmechanismen legen die Bilanzkreisverantwortlichen ihr jeweiliges Absicherungsniveau über die Anzahl der erworbenen Kapazitäts-Zertifikate fest. Im Gegensatz dazu legt im IKM die zuständige staatliche Stelle das für die Versorgungssicherheit nötige Absicherungsniveau fest „Wir setzen uns für einen Integrierten Kapazitätsmarkt ein, bei dem die Festlegung des Absicherungsniveaus der Versorgungssicherheit in staatlicher Verantwortung liegt und bei der Erfüllung desselben alle Technologien einbezogen werden. Der Staat setzt den politischen und rechtlichen Rahmen, die Unternehmen investieren und stellen die erforderlichen Kapazitäten, Speicher, Flexibilitäten und Demand-Side-Management (DSM) zur Verfügung“, sagt Kerstin Andreae. In der Studie werden sowohl zentrale als auch dezentrale Ansätze zur Integration von Flexibilitäten in einen Kapazitätsmarkt beleuchtet. Darüber hinaus werden die Erkenntnisse aus europäischen Kapazitätsmärkten herangezogen, um deren Ansätze zur Integration von Flexibilitäten zu evaluieren. Aufbauend auf diesen Analysen werden Maßnahmen diskutiert, die eine effektivere Einbindung von Flexibilitäten, inklusive DSM, in zentrale technologieoffene Ausschreibungen ermöglichen. Dazu äußert sich Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung: „Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Hebung von Flexibilitäten in einem Integrierten Kapazitätsmarkt (IKM) durch eine kluge Ausgestaltung des ohnehin notwendigen Umlagesystems angereizt werden kann.“ Die Notwendigkeit, einen Zertifikatehandel, wie bei einem dezentralen oder kombinierten Kapazitätsmarkt, einzuführen und zu betreiben, entfällt hierbei vollständig und spart somit Zeit und Kosten bei deutlich geringerer Komplexität des Gesamtsystems.“ Dieser integrierte Ansatz gewährleistet, dass die Versorgungsziele effizient und technologieoffen erreicht werden können, indem Synergien zwischen den verschiedenen Mechanismen genutzt werden. Der IKM schafft eine verlässliche Grundlage für Investitionen und eine effektive Integration von Flexibilitätslösungen. „Das Strommarktdesign ist zentral für die Gestaltung einer zukunftsfähigen, bezahlbaren, nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Energieversorgung. Die Weichen, die wir heute stellen, werden unser Stromsystem auf Jahre prägen. Es ist deshalb wichtig, dass die künftigen Regelungen zum Marktdesign die Energiewende voranbringen sowie Systemstabilität und Versorgungssicherheit gewährleisten. Sie müssen das Marktprinzip wahren sowie Kosten und Komplexität so gering wie möglich halten“, betont Kerstin Andreae. „Ein Kapazitätsmarkt muss in Bezug auf die beihilferechtliche Genehmigung, die Implementierung und die Administration mit möglichst geringer Komplexität umsetzbar sein, um Versorgungs- und Systemsicherheit kostengünstig und schnell zu gewährleisten.“ (BDEW, 17.03.2025) Ganzer Artikel hier… Download der kompletten Studie hier…